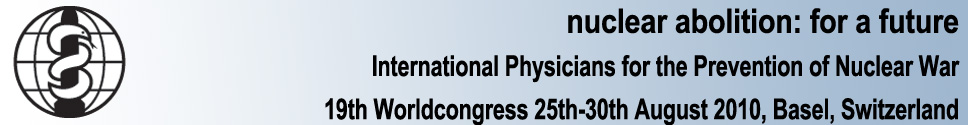Uranabbau: Zum Beispiel Niger
Der Spiegel 29.03.2010
NIGER
Der gelbe Fluch
Von Meyer, Cordula
Seit 40 Jahren schürft Frankreichs Staatskonzern Areva in einem der ärmsten Länder der Erde Uran für Europas Atomstrom - die schmutzigste Seite der Kernkraft. Arbeiter sterben, Wasser und Staub sind verseucht. Der Kampf um den Brennstoff schürt zudem Aufstände gegen die Regierung.
Der Mann aus Niger war gekommen, um mit dem Chef der größten deutschen Bank zu sprechen. Im Mai vorigen Jahres saß Almoustapha Alhacen in der Frankfurter Festhalle. Er hörte zu, wie Josef Ackermann verkündete, der Bank gehe es trotz Finanzkrise wieder besser. Ackermann sprach von Verantwortung, "Markt und Moral" seien keine Gegensätze, sondern würden "zum Wohle aller miteinander harmonieren".
Aber da, wo der Mann aus der Wüste herkommt, gibt es keine Harmonie von Markt und Moral. Davon wollte er Josef Ackermann erzählen; ein Verein kritischer Aktionäre hatte ihn zur Hauptversammlung eingeladen. Alhacen passte auf diese Veranstaltung so gut wie ein Außerirdischer: Er trug das Stammesgewand der Tuareg, mit Gesichtsschleier und Turban. Alhacen war ruhig, als er ans Rednerpult trat. Sein Gesicht flimmerte über die Großleinwand.
"Bonjour, Monsieur Ackermann", begann Alhacen auf Französisch mit afrikanischem Akzent. Er hatte fünf Minuten Zeit, um Ackermann die Katastrophe zu beschreiben, die er seit neun Jahren bekämpft. Er sei der Gründer einer Umweltorganisation aus der Stadt Arlit in Nordniger. Er sagte, dass der französische Konzern Areva dort Uran abbaue. Es gebe Millionen Tonnen radioaktiver Abfälle, verstrahltes Wasser, schwere Krankheiten. Und die Deutsche Bank gehe all das etwas an, weil sie Areva viel Geld leihe.
Alhacen sprach auch von Verantwortung, genau wie der Bankchef. Wer mit Krediten an die Uranindustrie Geld verdiene, müsse helfen "bei der Bekämpfung der gravierenden Probleme, die beim Uranabbau entstanden sind". Ackermann erwiderte, der Deutschen Bank liege der Umweltschutz am Herzen. Seitdem hat Alhacen nie wieder etwas von der Deutschen Bank gehört.
Alhacen gründete seine Organisation Aghirin Man vor neun Jahren, als er merkte, dass viele seiner Kollegen an rätselhaften Krankheiten starben. Aghirin Man heißt in seiner Tuareg-Sprache "Schutz der Seele".
Alhacen hat nie eine Schule besucht, und bis heute gibt es für ihn kaum etwas Schöneres, als auf einem Kamel zu reiten. Er hat dunkle Haut, er trägt einen Schnauzer. Wenn ihm etwas missfällt, zieht er den Schleier so übers Gesicht, dass nur noch seine Augen frei bleiben. Aghirin Man hat in Arlit zwei Zimmer neben einer Schneiderei. Ein befreundetes Arzt-Ehepaar aus Österreich hat alte Computer gespendet. Alhacens Bürostuhl fehlt eine Lehne. Roter Staub hat sich abgesetzt.
Diese zwei schäbigen Zimmer sind die Zentrale im Kampf gegen den Weltkonzern Areva.
Arevas Zentrale ist in Paris. Areva betreibt Uranminen und baut Kernkraftwerke. 2009 hat Areva 14 Milliarden Euro umgesetzt. Die Firma gehört fast komplett dem französischen Staat. Der war bis 1960 Kolonialmacht in Niger. Acht Jahre nach der Unabhängigkeit gründeten die Franzosen die erste Minengesellschaft. Vor Jahrmillionen war das Gebiet ein Flussdelta, in dem sich Uran in Sedimenten absetzte. Seit 1968 haben Bagger mehr als 100 000 Tonnen des Atombrennstoffs aus dem Saharaboden geholt.
Frankreich verkauft seinen Atomstrom auch nach Deutschland, und Areva beschäftigt in der Bundesrepublik 5200 Mitarbeiter. Jedes Wochenende laufen die Fußballer des 1. FC Nürnberg in Areva-Trikots auf. Frankreich hat 58 Reaktoren, sie liefern den Großteil des Stroms für das Land, und der Brennstoff dafür kommt aus Niger. Das Land ist einer der größten Uranlieferanten der Welt und für die Atomindustrie in etwa das, was Saudi-Arabien für die Erdölindustrie ist.
Uran aus Niger dient seit 40 Jahren als Treibstoff für Europas Energieversorgung. Aber im Gegensatz zu Saudi-Arabien hat Niger nichts davon, nur Elend. Das Land in der Sahelzone ist das am wenigsten entwickelte der Erde. Jedes vierte Kind stirbt vor seinem fünften Geburtstag.
Die Zustände in Niger sind eine schmutzige Seite der vermeintlich sauberen Atomenergie. Sie liegt gut verborgen, mitten im Nirgendwo. Es gibt Banditen in der Region, die Weiße entführen und an al-Qaida verkaufen. Die Gegend war wegen einer Tuareg-Rebellion lange im Ausnahmezustand. Noch heute ist Arlit nur per Militärkonvoi zu erreichen. Aber vor kurzem war ein Team von Greenpeace da. Die Mitarbeiter hatten Geigerzähler dabei. Und sie maßen viel zu hohe radioaktive Strahlung. Die beiden Uranminen, um die es geht, liegen in der Nähe von Arlit und der Nachbarstadt Akokan. In der einen wird Uran im Tagebau gewonnen. Die andere reicht etwa 250 Meter unter die Erde, es ist die weltgrößte Uranmine unter Tage. In den beiden Städten, die Areva für die Mine in die Wüste gesetzt hat, wohnen zusammen 80 000 Menschen. Es gibt keine Teerstraße, nur rotbraunen Staub, der sich in jede Ritze und Pore legt. Brunnenwasser ist radioaktiv belastet, kostbares fossiles Grundwasser wird in der Fabrik verbraucht. Nomaden finden immer weniger Futtergründe für ihr Vieh. Und es gibt todbringende Krankheiten.
Bürgerorganisationen kritisieren, das wenige, was Areva an den Staat zahle, bleibe in der Hauptstadt oder gleich in den Taschen der Familie des langjährigen Präsidenten. Wenn man Almoustapha Alhacen fragt, was die Mine den Menschen gebracht habe, sagt er: "Nichts - nur die Verstrahlung, die Jahrtausende bleibt."
Und die Aufstände, mit denen die Tuareg-Rebellen gewaltsam ihren Anteil an den Einnahmen aus dem Uran erkämpfen wollen. Niger ist ein geteiltes Land - im Norden leben die Tuareg, im Süden die dominierenden Haussa. Dort liegt auch die Hauptstadt, der Süden hat das Sagen in Niger. Mit dem Urangeld aus dem Norden kauft der Staat im Süden Waffen, mit denen er den Norden klein hält. In Sierra Leone schüren Diamanten Konflikte, in Niger ist es das Uran. Bluturan.
Arlit wurde einmal als "Zweites Paris" verklärt. Doch der Wüstenwind wirbelt nur roten Sand durch die Stadt. Arlit ist ein Ort in heißem rotem Monochrom. Die Häuser aus rotem Lehm, die Straßen aus rotem Staub, dazu der immer wieder von Sandstürmen verdunkelte Himmel.
Vom nordwestlichen Rand Arlits aus ist ein gewaltiger Berg zu erkennen: 35 Millionen Tonnen Abraum aus der Mine. Das Uran wurde herausgelöst, aber 85 Prozent der Strahlung sind noch da, durch Stoffe wie Radium und Thorium, deren Halbwertszeiten in Jahrtausenden gemessen werden. Der Abraum liegt offen herum, der Wüstenwind fegt darüber. Zwischen der Halde und der Stadt bauen die Menschen Tomaten und Salat an.
Männer verkaufen Benzin in alten Schnapsflaschen, auf denen noch das Pastis-Etikett klebt - eine Tankstelle in Arlit. Eine Frau mit drei Tomaten, zehn Kartoffeln und einem halben Glas Mayonnaise - das ist ein Restaurant in Arlit. Die Menschen haben sich aus Abfall Häuser gebaut. Alhacen zeigt auf Deckel und Böden von Fässern, die nun zu Mauern geworden sind, auf Plastikplanen, die jetzt Dächer sind. "Aus der Fabrik", sagt er.
2200 Menschen arbeiten dort. In der Fabrik zerkleinern Arbeiter die Felsbrocken, zermahlen sie zu Staub und lösen dann mit viel Wasser und Säure das Uran heraus. Am Ende bleibt ein gelber Teig: Yellow Cake. Der gelbe Kuchen wird in Fässer verladen, Konvois fahren die Fässer 2500 Kilometer weit nach Benin. Von dort aus gehen Schiffe nach Marseille.
Alhacen gehört zum Tuareg-Stamm der Agir in den Aïr-Bergen. Sein Vater führte Kamelkarawanen, sie brachten Salz und Datteln. Als Elfjähriger begleitete Alhacen seinen Vater das erste Mal. Knapp zehn Jahre später, 1978, wurde Almoustapha Alhacen Arbeiter in der Mine; er musste jene Maschinen reparieren, die die Steinbrocken zerkleinern. Im staubigen Overall ging er jeden Abend heim zu seiner Familie und spielte mit seinen Kindern. Seine Frau wusch die Kleider, die voll waren von radioaktivem Staub.
Nach dem Reaktorunglück von Tschernobyl 1986 hörte er das erste Mal von Radioaktivität. Er bekam nun eine Atemmaske aus Papier. Acht Jahre später musste er trotzdem wegen einer Staublunge aufhören. Er kam in einer neuen Abteilung unter, sie kümmert sich um Strahlenschutz. Alhacen ist noch heute dort beschäftigt. Aber die Firma hat ihn freigestellt. "Wegen unangemessenen Verhaltens, etwa unentschuldigten Fernbleibens von der Arbeit", sagt Areva. Er bangt um den Job, denn er braucht das Geld für seine 13 Kinder. Aber so hat er auch mehr Zeit für seinen Kampf - und die Opfer.
Zeit etwa, um die Witwe Fatima Taoka in ihrem Lehmhaus zu besuchen. Ihr Mann Mamadou bohrte in der Mine das Gestein in Stücke, bis er krank wurde. "Er war immer stark, aber dann hatte er nur noch Schmerzen und wurde dünn wie ein Stock", erzählt Fatima. Es war etwas in der Lunge und in den Nieren, sagt sie, aber was das war, habe man ihr im Krankenhaus nicht gesagt.
"Es lag am Staub", sagt sie. "Es war etwas Böses im Staub." Was Radioaktivität ist, weiß Fatima nicht. Ihr Mann starb 1999. In diesem Jahr starben mehrere Kollegen Alhacens. Vor allem solche mit Jobs, bei denen es staubt. "Sie starben an Krankheiten, die wir nicht verstanden", sagt Alhacen. Als er im Krankenhaus nachfragte, woran seine Kollegen denn gestorben seien, habe er keine Antwort bekommen. Manchmal hätten die Ärzte auch gesagt, es sei Aids. Alhacen schöpfte Verdacht. Die Aids-Rate in Niger war niedrig. Und das Krankenhaus gehört Areva. Als Mamadou dann starb, fasste Alhacen den Entschluss, Aghirin Man zu gründen.
Zehn Jahre ist das her. Seitdem hat er immer wieder Krankengeschichten gehört, die der von Mamadou ähneln. Auf seiner Tour besucht er auch Amalhe Algabit. Der ehemalige Vermessungsassistent hat noch seinen in Plastik eingeschweißten Arbeitsausweis mit der Nummer 1328. Seine Brust schmerzt, er versteckt seinen ausgemergelten Körper in einem weißen Umhang, das eingefallene Gesicht hinter einer großen Sonnenbrille. Oft glaubt er zu ersticken. Er weiß nicht, warum; er fürchtet nur, dass es nicht mehr lange geht: "Ich bin schon so dünn."
Der Ehemann von Rakia Agouma starb am 23. September 2009. 31 Jahre lang hatte er in der Mine Lastwagen mit den Gesteinsbrocken gefahren. Schon drei Jahre vor seinem Tod hatte er schlimme Schmerzen in der Brust und im Rücken, aber er versuchte, fröhlich zu bleiben, das hatte Rakia immer an ihm gemocht. Als er dann in der Areva-Klinik starb, hätten sie ihr gesagt, es sei Malaria: "Die Ärzte sagen nicht die Wahrheit, sie sind Lügner."
Areva sagt, jeder in Arlit und Akokan werde gratis behandelt, auch ehemalige Arbeiter. Bislang sei kein einziger Arbeiter an berufsbedingtem Krebs gestorben.
Der Franzose Serge Venel wurde nur 59. Sein Fall könnte wichtig werden, denn seine Leidensgeschichte ist von französischen Ärzten dokumentiert. Er war sieben Jahre Vorarbeiter in Akokan. Seine Tochter Peggy, 37, lebt südlich von Paris.
Weihnachten 2008 hustete Serge Venel das erste Mal. Dann nahm er 13 Kilo ab. Im März ging er zum Lungenfacharzt. Der Arzt fragte, ob er rauche.
"Seit 25 Jahren nicht mehr."
"Und was machen Sie beruflich?"
Serge Venel erzählte es ihm.
Der Arzt fragte nicht weiter nach.
Vier Monate später, am 31. Juli 2009, starb Serge Venel an Lungenkrebs.
Seine Tochter will, dass der Krebs ihres Vaters als Berufskrankheit anerkannt wird. Sie will, dass ihre Mutter eine Rente bekommt. "Wenn man für etwas kämpft, muss man es bis zum Ende machen."
Sie hat einen kleinen Verein gegründet. Auch Peggy führt nun eine Liste der ehemaligen Angestellten. Die Namen der Verstorbenen sind darauf orangefarben, die Namen der Krebskranken sind rot. Peggy Venel hat auch einen Fragebogen für Ex-Arbeiter ins Internet gestellt. Die Antworten ähneln sich.
Was haben Sie bei der Arbeit getragen?
"Hemd und Shorts."
Hatten Sie einen Dosimeter?
"Nein."
Gab es Schutzhandschuhe?
"Nein."
Peggy sagt, sie könne bis heute nicht verstehen, wie Areva "das machen konnte und nun die Hände in Unschuld wäscht. Die haben die Leute ja umgebracht". Peggy Venels Anwalt sagt: "Dies könnte der erste Fall aus Niger sein, bei dem Lungenkrebs als Berufskrankheit anerkannt wird."
Das wäre auch für Alhacen ein Meilenstein. Denn er kämpft um Beweise. 2003 holte er Bruno Chareyron nach Arlit, einen Kernphysiker aus Valence im RhôneTal. Chareyron war Ingenieur in einem Atomkraftwerk. Seit mehr als 25 Jahren arbeitet er im Labor von Criirad, einer unabhängigen Strahlenschutzorganisation. Er maß die Strahlung in der Nähe der Fabrik, auf dem Altmetallmarkt in Arlit, in den Straßen. Er nahm Wasserproben.
Dann kam Sherpa, eine Anwaltsorganisation aus Paris, die für die Rechte von Arbeitern kämpft. Eine Sherpa-Anwältin interviewte über 80 Minenarbeiter. Sie hörte immer wieder dieselben Geschichten: Bis Mitte der achtziger Jahre gab es keine Sicherheitsausrüstung, nicht einmal Staubmasken.
Eine Familie beteuerte, Ärzte hätten einen hustenden Minenarbeiter aus dem Areva-Krankenhaus in Arlit mit einer Diabetes-Diagnose heimgeschickt. Der Mann reiste in die nächstgrößere Stadt Agadez. Dort habe der Arzt Lungenkrebs im fortgeschrittenen Stadium gefunden.
Die Sherpa-Anwältin konfrontierte den Chefarzt des Krankenhauses. Der rechtfertigte sich, man sage Patienten nie, dass sie Lungenkrebs hätten. Ein anderer Mitarbeiter des Krankenhauses gab zu, dass Krebs höchstens bei Patienten diagnostiziert werde, die nicht in der Mine arbeiteten. "Wenn Arbeiter diese Symptome zeigen, wird von Malaria oder Aids gesprochen." Areva sagt, die Firmenärzte seien "unabhängig", die Vorwürfe "verleumderisch". Die Doktoren hätten "alle Ausstattung, die sie brauchen".
Im vergangenen November kamen dann die Leute von Greenpeace. Sie blieben neun Tage. Und sie fanden überall erhöhte Strahlung. Eine Sandprobe aus der Nähe der Mine in Akokan enthielt 100-mal mehr radioaktive Stoffe als normaler Sand. In den Straßen von Akokan fanden die Greenpeace-Leute sogar Strahlung, die 500-mal höher war als normal. Früher wurde der radioaktive Abraum der Mine als Baumaterial für Straßen und Häuser benutzt. Von fünf Wasserproben lagen vier über den Richtwerten der Weltgesundheitsorganisation für Uran. Nach Aussage von Areva ist die jährliche Strahlendosis für die Einwohner geringer als bei einem Brust-Röntgenbild.
Alhacen durchstöbert seit Jahren den Schrottmarkt von Arlit nach Strahlenquellen. Früher machten die Menschen Werkzeuge aus dem Schrott, manchmal sogar Kochtöpfe, aus denen sie täglich aßen. Die Firma hat aufgeräumt und viele strahlende Abfälle eingesammelt.
Seit 2002 erfülle der Konzern höchste internationale Standards zur maximalen Strahlendosis, beteuert Areva. Joseph Brehan sagt: "Die Verbesserungen sind nicht so groß." Der Anwalt aus Paris reiste kürzlich nach Arlit, um seinen Klienten zu treffen: Almoustapha Alhacen. Im vorigen Jahr unterschrieb Areva einen Vertrag, der Sherpa das Recht gibt, die Arbeitsbedingungen in den Minen zu prüfen. Im Gegenzug muss Sherpa sich mit Areva absprechen. Zusammen wollen sie ein umfassendes Gesundheitsüberwachungssystem einführen.
Der Physiker Chareyron und der Aktivist Alhacen glauben, dass Sherpa einen Pakt mit dem Teufel eingegangen ist.
Das ist das Problem mit einem mächtigen Konzern. Criirad, Aghirin Man und Sherpa sind kleine Organisationen. Sie leben von Spenden, und so ist selbst Alhacen ein Kritiker, den sich Areva gerade noch leisten kann. Denn auch er hat seinen Pakt mit dem Teufel geschlossen. Noch immer ist er bei Areva beschäftigt. Die Firma hat ihn zwar wieder freigestellt; aber Alhacen wohnt mietfrei in dem Areva-Haus RA4, No 6. Das Haus hat vier Zimmer, in einem Verschlag im Innenhof leben vier Ziegen - nach den Standards von Arlit ist Alhacen ein wohlhabender Mann. "Wenn ich den Job verliere, muss ich aus dem Haus - sofort."
Es gibt keine andere Arbeit in Arlit als die in der Fabrik. Arlit ist Areva.
So ist selbst Alhacen ein Kritiker, der von Areva abhängig ist.
Im Norden Nigers sind ein Drittel der Kinder unterernährt, Tausende sterben an Durchfall und Lungenentzündung. In Niger könnte viel Leid mit wenig Geld verhindert werden. Ist es richtig, in so einem Land dieselben strengen Maßstäbe zum Schutz vor Radioaktivität zu fordern wie in Europa?
Areva will in den nächsten fünf Jahren sechs Millionen Euro jährlich für Entwicklungsprojekte ausgeben. Vor ein paar Jahren verteidigte sich Areva mit dem Argument, es sehe sich nicht vorrangig als Wohltätigkeitsorganisation. Niger helfe es auch, wenn die Menschen Arbeit bekämen und der Staat Einnahmen aus dem Uran.
Alhacen verliert die Fassung, wenn er das hört. "Wer hat denn von Wohltätigkeit gesprochen? Es ist unser Uran! Arevas Wohltätigkeit, das ist Verschmutzung, von der wir für immer etwas haben. Areva verübt hier ein Verbrechen. Sie nehmen das Wasser, und deshalb verschwinden die Bäume und Pflanzen. Es gibt kein Leben. Und wofür? Für eure Energie."
Das Uran verschärft außerdem den Konflikt zwischen den Tuareg-Rebellen im Norden und der Regierung im Süden. Der letzte Aufstand endete erst vor wenigen Monaten. Schon in den neunziger Jahren herrschte Bürgerkrieg zwischen Nord und Süd. Mohammed Anacko war damals ein Führer der Rebellion. Inzwischen leitet er eine Versöhnungskommission. Zum Rebell wurde er einst, weil der Norden nichts bekam von den Uraneinnahmen.
Heute sorgt er sich, Niger könne zerfallen. Jeden Monat reist Anacko zu den Rebellen ins Aïr-Gebirge, östlich der Uranminen; er redet mit den Kämpfern, weil er den wachsenden Einfluss von al-Qaida fürchtet. Schon jetzt sind viele der Ex-Rebellen aufs Drogen- und Menschenschmuggeln umgestiegen. Und was, wenn jemand versuchte, Uran zu schmuggeln?
Chaos in einem Land mit Uranreserven ist immer gefährlich. So hatte der Mitte Februar von Militärs weggeputschte Präsident Mamadou Tandja gedroht, seinen Yellow Cake an Iran zu verkaufen. Der Mann ist weg, aber die Idee bleibt. Das fürchtet der Westen.
Die Tuareg dagegen fürchten den totalen Ausverkauf ihres Landes. 2007 war ein Höhepunkt der weltweiten Atomrenaissance, der Handelspreis von Yellow Cake schoss in die Höhe. Präsident Tandja vergab mehr als 100 Explorationslizenzen für Urangebiete. Die Lizenzgebiete überziehen das Land der Tuareg fast vollständig.
"Die Tuareg leben von ihren Tieren", sagt Alhacen. "Sie können nirgendwo anders hin. Sie leben von diesem Land, und es gehört ihnen." Damit sie wenigstens noch eine Chance haben, will er weiterkämpfen. Im vorigen Jahr war er auch bei den Gorleben-Gegnern im Wendland. "Das war wunderbar, weil es mein Lebensstil ist", sagt der Tuareg. "Es gibt viel freies Land und viel Milch."
Alhacen hielt einen Vortrag in Dannenberg: "Ihr dürft nicht nur gegen Kraftwerke und Endlager kämpfen. Wenn ihr den Baum töten wollt, tötet die Wurzeln."
Er meinte die Uranminen.